Dieser Artikel ist 2-geteilt. Im ersten Teil erfährst Du etwas mehr über ein paar psychologische Annahmen und Modelle aus dem Bereich der Trauer-Forschung und Trauerbegleitung.
Im 2. Teil lade Dich in verschiedenen Absätzen dazu ein, unabhängig von psychologischer Fachsprache für Dich zu spüren, in welchem der Absätze Du Dich am meisten wiederfinden könntest.
Dennoch beginne ich mit einer kurzen Mini-Vorstellung div. Modelle und Annahmen.
Damit möchte ich Dir auch zeigen, dass Du mit Deiner Trauer nicht allein bist.
Es ist ein so großes existenzielles Thema, dass es Gegenstand der Forschung war und ist. Im kollektiven Raum dient es auch der Sprachfindung – wie benenne ich mich, wie meinen Zustand, wie kann ich damit vor allen Dingen für mich selbst forschen und lauschen?
Und natürlich ist es nichts Neues, dass Sprache seine Grenzen hat und jedes Modell eine Landkarte ist, aber nicht die Landschaft selbst.
Aber lass uns mal einsteigen:
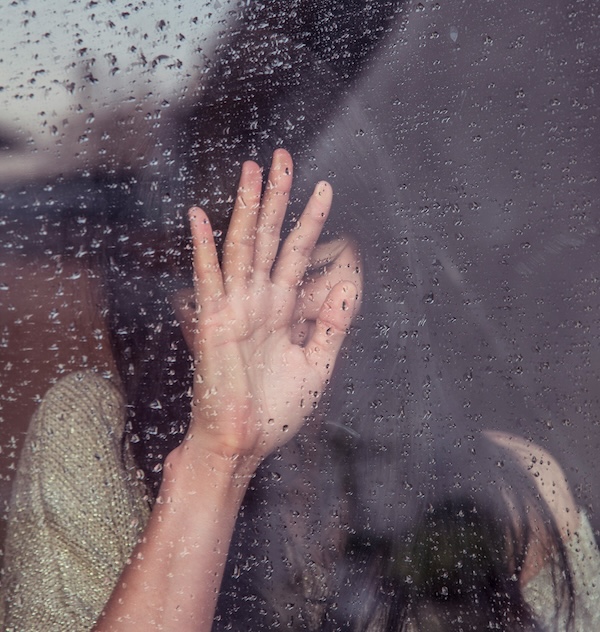
Psychologische Modelle der Trauer im Vergleich
Das klassische Modell: Die fünf Phasen der Trauer (Kübler‑Ross)
Elisabeth Kübler‑Ross prägte 1969 das Modell der fünf Phasen: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz
Heute gilt: Das Modell basiert auf anekdotischen Beobachtungen kurzzeitig erkrankter Patienten, nicht auf empirischer Forschung bei trauernden Angehörigen
Kübler‑Ross selbst soll später gewarnt haben, dass die Phasen nie als linear oder universell gedacht gewesen seien.
Kritikpunkte:
Fehlender empirischer Nachweis, viele Forschungsergebnisse widersprechen der Phasentheorie.
Der Ansatz kann trauernde Menschen unter Druck setzen („Du trauerst falsch“) und sozialen Druck erzeugen. Durch die Annahme der stringenten Abfolge in immer gleicher Reihenfolge, fanden sich viele Menschen nicht wieder, die die Phasen anders oder nicht alle 5 durchlaufen haben. Menschen, die das Modell kannten, fragten sich potenziell selbst: Was stimmt nicht mit weil, weil ich beispielsweise die Phase der Wut nicht hatte?
In populären Medien bleibt das Modell weit verbreitet – trotz intensiver Kritik durch Wissenschaftler wie beispielsweise Bonanno, Neimeyer, Stroebe & Schut
Dual-Process-Modell (Stroebe & Schut)
Pendelt zwischen traumbasierter Arbeitsweise (Inneres Erleben) und Restorationsarbeit (Alltagsbewältigung).
Kurz zusammengefasst oder in einfachen Worten:
Innenleben und wie ich meinen Alltag in den jeweiligen emotionalen Welten für mich bewältigen kann. Könnte ähnlich auf die Ressourcen-Arbeit abzielen und damit auf die Stärkung der Resilienz wie das folgende Modell von Bonanno
Trauer wird als oszillierender Prozess beschrieben.
Mögliche Kritikpunkte:
In der Praxis ist das Pendeln oft nicht klar abgrenzbar: Menschen erleben Trauer und Alltag oft gleichzeitig, nicht in separaten Phasen. Je nach Bewusstseinsebene ist auch völlig verständlich, dass Gleichzeitigkeit verschiedener Qualitäten völlig normal sind. Doch wenn ein Modell davon ausgeht, dass die Phasen klar abtretbar sind, dann hinkt mal wieder die Landkarte der Landschaft hinterher. Diese Kritik haben die Autoren doch wohl auch selbst anerkannt.
Der Fokus auf dosiertes Aussetzen – also das strenge Annehmen, dass jetzt von Fühlen in die Handlung zu wechseln sei, scheint manchen Betroffenen nicht genug Raum zu lassen, besonders bei intensiven oder traumatischen Verlusten.
Begriffe wie „Balance“ können implizieren, dass Kontrolle oder Anpassung wichtiger sind als innere Erfahrung oder Wahrnehmung, was in bestimmten Fällen als Druck erlebt werden kann.
Resilienzmodell (Bonanno)
Die Annahme dahinter:
Viele Menschen erholen sich ohne Therapie oder Intervention durch innewohnende Resilienz. Und ebenso: Trauerende müssen nicht zwingend Leidenspfade durchlaufen, sondern können klar und stark bleiben.
Kritikpunkte:
Vage Definitionen aus wissenschaftlicher und sprach-stringenter Sicht: Resilienz wird sehr breit gefasst – als Charakterzug oder Zustand. Das macht Vergleiche schwierig und die Ergebnisse
Individueller Fokus: Der Begriff kann dazu führen, Verantwortung allein auf die Betroffenen abzuleiten – statt strukturelle oder kulturelle Unterstützung zu fördern. Hier werden eben nicht die anderen Quadranten wie die kollektive Innenwelt und die Einbettung des Individuums in Systeme (Quadranten sind als die 4 Quadranten nach Ken Wilber gemeint)
„Coping ugly“: Praktiken wie emotionale Verdrängung werden nicht pauschal abgewertet – manchmal sind sie hilfreicher als Ausdruck tiefer Trauer. Kritiker warnen, dass das Maskentragen gegenüber innerem Leiden missverstanden werden kann. Dieser Kritikpunkt wäre vergleichbar mit z.B. einer häufig genutzten Coaching-Idee, wenn es um Erfolg geht: Fake it till you make it – auch dies hat z.T. seine Berechtigung, wenn das Wegschauen oder Wegdrängen dadurch nicht überhand nimmt.
Unbegrundete Resilienz-Erwartung: Manche Ausprägung von Resilienz wird als Norm angesehen – das kann Menschen ohne sichtbares „Leiden“ pathologisiert darstellen. Manche Trauerzeiten können sich auch über Jahre zeigen. Oder für einige Zeit „verarbeitet“ und Jahre später kann ein tiefes Vermissen auftreten. Auch die Umwelt könnte nach einer gewissen Zeit, die sie als eine „normale“ Trauerzeit in eine Haltung von „Hab dich nicht so!“ Gegenüber des Trauernden verfallen.
Bevor wir zum 2. Teil meines Artikel übergehen hier noch ein paar Anmerkungen aus anderen Forschungsbereichen
Neurobiologische Perspektiven auf Trauer (z.B. O’Connor & andere)
Mary-Frances O’Connor verbindet Neurowissenschaft und klinische Psychologie.
Ihr Fokus liegt auf der Frage: Was passiert im Gehirn, wenn wir trauern?
Zentrale Erkenntnisse:
Trauer aktiviert dieselben Hirnareale wie Bindung und Belohnungssysteme (z. B. Nucleus Accumbens, präfrontaler Cortex).
Besonders bei komplizierter Trauer (Prolonged Grief Disorder) zeigt sich eine anhaltende Aktivierung dieser Areale – der Verlust wird „nicht verarbeitet“, sondern wie ein fehlender, aber noch existierender Mensch erlebt.
Trauer ist biologisch kein Ausnahmezustand, sondern eine Anpassungsleistung des Gehirns, vergleichbar mit Lernen.
Auch Vera Birkenbihl spricht in einem ihrer vielen Vorträge dazu, dass Trauer tief in die Verarbeitungsprozesse des Gehirns eingreifen kann oder sich der Hormonhaushalt verändert, so dass daraus auch sich selbst verstärkende Feedbackschleifen entstehen können. Sie betonte u.a. auch, dass es auch aus diesem biologischen Fakt heraus gesellschaftlich legitim sein sollte, die Kultur des Trauerjahres zu reaktivieren, um dem Gesamtsystem auch eine gesellschaftlich anerkannte Zeit zu geben.
Der 2. Teil meines Artikels: Und was fühlst Du gerade in Dir? Lies mal in Ruhe die verschiedenen Absätze und lass ressonieren, wie es jetzt gerade für Dich erscheinen mag.

Nun ist sie da, die Tatsache, dass ein geliebter Mensch gegangen ist.
Vielleicht fragst Du Dich, warum das nur geschehen musste. Warum Gott das zugelassen hat. Oder Du bist vielleicht schon ein Stück mehr im Frieden – vielleicht mit dem Gedanken, dass Gott diesen Menschen zu sich geholt hat. Du spürst vielleicht, dass Du nun selbst Gott näher sein möchtest: durch ein Gebet, einen Gottesdienstbesuch oder das Entzünden einer Kerze. Etwas Konkretes, das Dir Halt gibt. Etwas, das bleibt, wenn so vieles gerade nicht mehr ist.
Oder Du glaubst nicht an Gott – zumindest nicht so, wie man es Dir beigebracht hat. Und doch spürst Du, dass da etwas fehlt. Vielleicht findest Du Trost in Gesprächen mit Menschen, denen Du vertraust. Vielleicht möchtest Du verstehen, was in Dir geschieht – emotional, psychologisch, körperlich. Du liest Bücher, hörst Podcasts, suchst Erklärungen. Vielleicht willst Du das, was war, ehren, indem Du Deinem Leben nun eine neue Richtung gibst. Du willst Verantwortung übernehmen. Für Dich. Für das, was bleibt.
Oder Du spürst: Da ist mehr. Die Seele geht nicht verloren. Es gibt ein Danach – auch wenn wir nicht genau sagen können, wie es aussieht. Vielleicht möchtest Du etwas gestalten, ein Ritual, einen Kreis mit anderen. Vielleicht ist es Dir wichtig, die Verbundenheit zu feiern, das große Ganze zu spüren. Nicht nur Schmerz. Auch Liebe.
Vielleicht ist es für Dich nicht so leicht greifbar. Du fühlst Dich leer. Oder alles ist zu viel. Vielleicht bist Du gar nicht traurig – und fragst Dich, ob das in Ordnung ist. Und ja, auch das ist eine Form von Trauer. Manchmal schützt uns das Leben, indem es uns betäubt. Oder es ist einfach noch nicht an der Zeit, etwas zu fühlen. Oder, oder, oder…
Du musst nicht wissen, wie Du trauerst. Du musst nicht funktionieren.
Was immer Du fühlst – oder nicht fühlst – ist in Ordnung. Es gibt nicht DIE eine „richtige“ Art zu trauern. Nur Deine. Und vielleicht hat Dir dennoch der 1. Teil des Artikels ein Stück weit Orientierung gegen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ich begleite Menschen dabei, herauszufinden, was ihnen jetzt gut tut – jenseits von Erwartungen, Ratschlägen und gesellschaftlichen Normen. Wenn Du magst, auch Dich.


